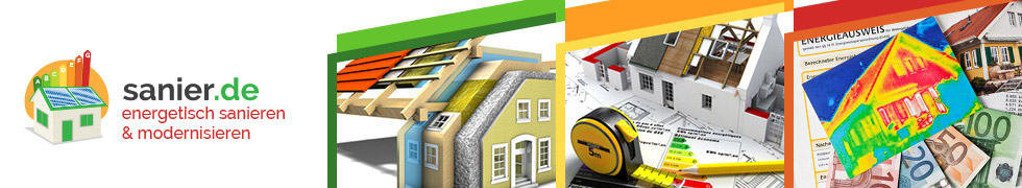Das Deckvermögen und die Deckkraft beziehen sich beide darauf, wie gut eine Farbe oder ein Lack in der Lage sind, den Untergrund zu überdecken. Es gibt allerdings feine Unterschiede in der Verwendung der beiden Begriffe.
Das Deckvermögen bezieht sich auf die Fähigkeit einer Farbe oder eines Lackes, den Untergrund vollständig zu verbergen und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen. Es beschreibt damit die Effektivität der Farbe beim Verdecken des Untergrundes.
Die Deckkraft hingegen beschreibt, wie gut eine Farbe oder ein Lack in der Lage ist, eine bestimmte Fläche abzudecken oder zu bedecken. Sie kann daher auch als Maß für die Effizienz einer Farbe bei der Erzielung der gewünschten Farbintensität ist, unabhängig von den Eigenschaften des Untergrundes.
In der Umgangssprache werden die Begriffe „Deckkraft“ und „Deckvermögen“ meist synonym verwendet, was auch daran liegt, dass bei Lacken und Farben deren Deckkraftklassen angegeben werden, während von „Deckvermögensklassen“ praktisch nie die Rede ist. Auf Englisch werden die Begriffe hiding power (Versteckkraft) und spreading rate (Verbreitungs/Verteilungsrate) genutzt, hierzulande sprechen Maler und Lackierer auch vom „Kontrastverhältnis“.

Malerkosten-Rechner:
Kosten berechnen für Malerarbeiten, Tapezierarbeiten oder Putzarbeiten
Welche Deckkraftklassen gibt es, und wie wird jede Deckkraftklasse definiert?
Es gibt gemäß der Norm DIN-EN 13300 insgesamt vier Deckkraftklassen, die wie folgt definiert sind:
- Deckkraftklasse 1: Diese Klasse hat das beste Deckvermögen, da die Farbe über 99,5 % des Untergrundes abdeckt. Farben in dieser Klasse erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und gelten als sehr gute Wandfarben.
- Deckkraftklasse 2: Farben dieser Klasse decken zwischen 98 und 99,5 % des Untergrundes ab.
- Deckkraftklasse 3: Diese Klasse umfasst Farben, die zwischen 95 und 98 % des Untergrundes abdecken.
- Deckkraftklasse 4: Farben dieser Klasse decken weniger als 95 % des Untergrundes ab, was bedeutet, dass sie das niedrigste Deckvermögen haben.
Um die Qualität von Wandfarben zu bewerten, können Sie neben dem Deckvermögen bzw. der Deckkraftklasse weitere Faktoren wie die Nassabriebbeständigkeit (Reinigungseigenschaften, Strapazierfähigkeit) oder Wohngesundheit vergleichen.

Welche Farben decken am besten?
Farben mit anorganischen (mineralischen) Pigmenten haben tendenziell das beste Deckvermögen. Denn anorganische Pigmente haben im Vergleich zu organischen einen höheren Brechungsindex, was bedeutet, dass sie Licht effektiver streuen. Dadurch können sie den Untergrund besser abdecken und ein gleichmäßigeres Erscheinungsbild erzeugen.

Ein Beispiel für ein anorganisches Pigment mit ausgezeichnetem Deckvermögen ist Titandioxid, das in vielen weißen Farben und Lacken verwendet wird. Durch seine hohe Lichtstreuungsfähigkeit ist es sehr effizient darin, Untergründe zu verbergen und opake (lichtundurchlässige, undurchsichtige) Beschichtungen zu erzeugen. Auch Bariumsulfat und verschiedene Metalloxide punkten mit hohem Deckvermögen.
Das vergleichsweise schlechtere Deckvermögen von Farben mit organischen Pigmenten rührt daher, dass organische Pigmente oft eine geringere Teilchengröße haben und beim Decken das Licht hauptsächlich absorbieren, statt es zu streuen wie Mineralpigmente. Manche organischen Pigmente haben zudem eine begrenzte Absorptionsbandbreite, was bedeutet, dass sie nur bestimmte Farben absorbieren und andere reflektieren. Das führt üblicherweise zu mehr Transparenz und weniger Deckkraft, insbesondere beim Streichen und Überstreichen von dunklen oder intensiven Farbtönen.

Ein Beispiel für ein organisches Pigment mit geringer Deckkraft ist Gelbpigment. Gelbpigmente absorbieren Licht nur in einem kleinen Bereich des sichtbaren Spektrums und erscheinen daher oft deutlich transparenter und weniger deckstark als andere Farben.
TIPP
Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Angebote von regionalen Malern und Verputzern vergleichen und sparen
Wie werden Deckvermögen bzw. Deckkraft von Farben ermittelt/gemessen?
Das Deckvermögen einer Farbe kann qualitativ und quantitativ gemessen werden. Eine qualitative Messung des Deckvermögens erfolgt durch das Auftragen einer definierten Farbschicht auf einen kontrastreichen Untergrund, oft eine Kontrastkarte mit Schwarz und Weiß. Das Ziel dabei ist, zu beurteilen, wie effektiv die Farbe den Untergrund abdeckt und ob eine gleichmäßige Farbschicht entsteht. Die quantitative Messung erfolgt nach dem Trocknen oder Aushärten der Farbe. Dazu wird der Farbabstand zwischen dem freien und dem gefärbten Untergrund gemessen. Das geschieht mit speziellen Messinstrumenten, die den Grad der Farbabdeckung genau erfassen können.

Die EN 13300 legt auch ein Verfahren zur Messung des Kontrastverhältnisses bei Innendispersionsfarben fest. Dabei werden die Farbschichten auf einen kontrastreichen Untergrund aufgetragen; anschließend wird gemessen, wie viel vom Untergrund durch die Farbe abgedeckt wird.
Zusätzlich kann die deckende Schichtdicke bestimmt werden, indem man mehrere Beschichtungen mit unterschiedlicher Schichtdicke herstellt und diese vergleicht. Die Schichtdicke, oberhalb der sich die Deckung bzw. Deckeigenschaften nicht mehr ändern, gilt als deckend. Auch dazu gibt es Normen, etwa DIN 55987 und ASTM D 2805-70, die jedoch unterschiedliche Eckdaten festlegen.

Was ist der „Dry-Hiding-Effekt“?
Der Dry-Hiding-Effekt führt dazu, dass viele billige Wandfarben trotz eines vergleichsweise geringen Anteils an hochwertigen Pigmenten den Untergrund gut abdecken und gleichmäßige Farbaufträge ermöglichen.
Günstige Wandfarben, etwa weiße Dispersionsfarben aus dem Discounter, enthalten statt hochdeckender Weißpigmente wie Titandioxid oft weniger deckstarke anorganische Füllstoffe wie Kreide oder Bariumsulfat. Werden diese Füllstoffe jedoch in sehr hohen Konzentrationen verwendet, entstehen beim Trocknen (dry hiding = trockenes Decken) winzige „Lufttaschen“ zwischen den Pigmenten/Farbpartikeln und Füllstoffen. Licht, das auf diese Lufttaschen trifft, wird reflektiert und verstärkt. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Farbe den Untergrund optisch besser abdeckt, als es tatsächlich (z. B. chemisch oder bauphysikalisch betrachtet) der Fall ist.
Ein ähnlicher Effekt tritt ein, wenn Sie eine Wand mit kleinen Unebenheiten weiß streichen. Selbst wenn Sie dabei nicht jede Unebenheit komplett mit Farbe abdecken, reflektiert die Farbe das Licht so, dass die Unebenheiten weniger auffallen und die Wand gleichmäßiger erscheint. Und das funktioniert nur, weil unsere Augen und Gehirne auch bei der Farbwahrnehmung sehr individuell, nicht nach DIN und insgesamt alles andere als zuverlässig arbeiten.


Wandfarbe Qualität
Wodurch lässt sich die Qualität einer Wandfarbe bestimmen? Welche Farbe ist für die Innenwand am besten geeignet? Woran ist eine… weiterlesen